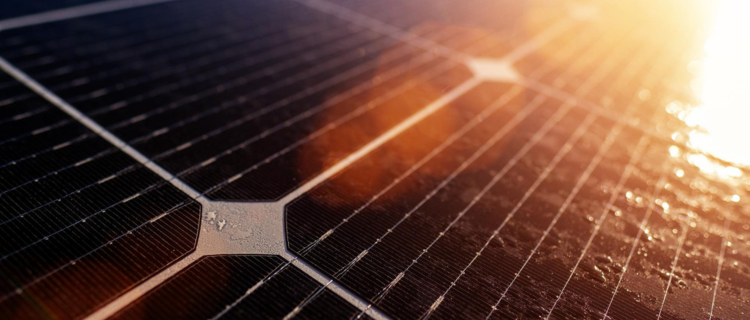8 Argumente für Photovoltaik
1) Skalierbarkeit
Photovoltaik funktioniert von der Balkon-Solaranlage mit Abmessungen von bspw. 2,38 x 1,13 m (ca. 700 W) bis hin zum Solarpark mit Flächen von mehreren Hektar. In Teutschenthal befindet sich zum Beispiel ein Solarpark auf 12,6 ha (mit 46432 Modulen) und einer installierten Leistung von 13,5 MW. Das bedeutet, dass sich vom Unternehmer bis zum Single-Haushalt jeder und jede beteiligen kann. Die Möglichkeit, viele kleine Anlagen dezentral zu installieren und Teile des Stroms direkt vor Ort zu nutzen, führt schließlich zu einer Entlastung der Stromnetze.
2) Variabilität des Standorts
Die Flexibilität in der Anlagengröße ermöglicht die Anwendung sowohl auf dem Land als auch in der Stadt - ohne räumliche Beschränkungen. Auch für die Verkehrswende in der Stadt ist die platzsparende Kombination von Elektromobilität mit PV auf Dächern, Carports und Parkplätzen sowie an Fassaden eine wichtige Voraussetzung.
3) Niedrigste Stromkosten
Nach einer Studie des Fraunhofer ISE von 2021 kostet die Erzeugung von Solarstrom zwischen 3,12 und 11,01 Ct/kWh, je nach Anlagentyp und Sonneneinstrahlung. Damit ist dies die günstigste Art Strom zu erzeugen. Ab 2024 werden Stromgestehungskosten für alle PV-Anlagen (ohne Speicher) unter 10 Ct/kWh liegen. Der Bau von neuen konventionellen Kraftwerken führt dagegen zu Stromgestehungskosten von mindestens 7,5 Ct/kWh und steigt weiter durch den Anstieg der CO2-Steuer. Der VDI ermittelte Kosten unter 4 Ct/kWh für PV-Großanlagen, im Betrieb nach der wirtschaftlichen Abschreibung fallen diese Kosten unter 1 Ct/kWh.
4) geringe Projektdauer
Für PV-Großprojekte werden von der Planung bis zur Inbetriebnahme Zeiten von 6 bis 18 Monaten angegeben, die vergleichsweise gering sind. Im privaten Bereich liegt die Dauer darunter, hier hängt sie maßgeblich vom Netzanschluss durch den Netzbetreiber ab und kann mehrere Monate betragen.
5) Langlebigkeit
Die technische Lebensdauer von PV-Anlagen beträgt 30 Jahre und mehr. Das heißt auch nach dem Auslaufen einer EEG-Förderung können sie noch einige Jahre „konkurrenzlos günstigen Strom“ für die öffentliche Versorgung liefern.
6) Abnahme des Flächenbedarfs
Die Zunahme der Modulleistung führte in den letzten Jahren zu einer deutlichen Erhöhung der installierten Leistung. Die benötigte Fläche sank von 4,1 ha/MW (2006) auf 1 ha/MW (2021). Damit sank der Flächenbedarf um 75 %. Die Stromerzeugung aus PV ist damit aktuell etwa 40-mal effizienter als die Stromerzeugung aus Biogas unter Mais-Einsatz.
7) Mehrfachnutzung von Flächen
Weiterhin senkt die Nutzung von bereits versiegelten Flächen - also den Dachflächen im privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereich - den Bedarf an Freiflächenanlagen. Diese Betrachtung lässt sich auf Biotopflächen und Agri-PV ausdehnen.
Bereits 4 % der deutschen Agrarflächen würden den aktuellen Strombedarf (1700 GW) decken. Dafür würden die Flächen des Gartenbaus (Dauerkulturen wie Obst, Wein und Sonderkulturen) genügen. Im Bereich Agri-PV ist mit Ernteeinbußen von bis zu 20 % zu rechnen. Allerdings sind auch Ertragsüberschüsse möglich, da die Solarmodule als Schattenspender und Hagelschutz wirken und die Austrocknung der Böden verringert werden kann. Der erzeugte Ökostrom kann direkt im landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt werden. Mehr erfahren
8) Hohe Naturverträglichkeit
Durch die Nutzung der Flächen zur Stromerzeugung entfällt die ökonomische Nutzung des Grünlandes. Deshalb werden kaum oder kein Dünger und Pflanzenschutzmittel verwendet. Außerdem sind die Mahdzyklen reduziert, da die Heugewinnung nur eine untergeordnete Rolle spielt. Breitere Reihenabstände zwischen den Modulflächen vergrößern die besonnte Fläche und erhöhen die Arten und Individuenzahlen (Insekten, Reptilien, Brutvögel). Große Anlagen können sogar Habitate ausbilden, die den Aufbau von Populationen ermöglichen (z.B. Zauneidechsen oder Brutvögel). Zusätzlich profitieren konkurrenzschwache Arten von Schafbeweidung statt Mahd, wenn offene Bodenstellen für die Keimung benötigt werden. Ferner wird durch den Aufbau von Humus in Dauergrünland (gegenüber Ackerböden) ein Beitrag zur CO2-Speicherung erzielt. Da häufig ein Monitoring fehlt, sind Aussagen zu Tiergruppen oft schwierig. Hier besteht Handlungsbedarf. Mehr erfahren